| |
Die
Zeit, in der es noch zwei deutsche Staaten gab, gerät immer weiter
in Vergessenheit. Hiermit rufe ich alle Wessis und Ossis auf, mir ihre
Erinnerungen zu schreiben. Dabei sollte der Alltag im Vordergrund stehen.
Bisherige
Beiträge:
Eigene
Erinnerungen an die DDR
Erinnerungen von Kati Lindemann
C. Franziska Richter: Diesseits der Mauer

Trabi in Ost-Berlin
1984
Eigene
Erinnerungen an die DDR:
Beim
jedem Besuch in Ost-Berlin mußten Westdeutsche 25 DM in 25 Ostmark
tauschen. Dadurch entstand ein gewisser Zwang, das Geld an dem Tag auch
auszugeben. Einmal kam ich auf den Gedanken, Tischtennisschläger
und -bälle zu kaufen. Das Kaufhaus "Zentrum" am Alexanderplatz
bot davon eine reiche Auswahl. Als ich ein Jahr darauf wiederkam, dachte
ich erneut daran, ein paar Bälle zu kaufen. Doch diesmal waren keinerlei
Tischtennis-Utensilien mehr zu sehen. Ich fragte nach und erhielt die
Auskunft: "Warum? Die hatten wir doch letztes Jahr!"

Dresden 1985 - Nationalpatriotismus aller Orten
1985
besuchte ich eine Freundin in Dresden. Sie hieß Maria und arbeitete
im VEB Anlagenbau Otto Buchwitz. Ob ich mal mitkommen wollte, fragte sie.
Sie hätte sowieso nichts zu tun. Ich hatte ein wenig Schiß,
aber interessant stellte ich es mir schon vor. Also ging ich mit. Ohne
Kamera. Sehr ungewöhnlich für mich, aber als Spion verhaftet
zu werden war damals nicht mein Lebensziel.
Durch
mehrere Ferienjobs, u. a. bei BOSCH in Stuttgart-Feuerbach, wußte
ich, wie eine Fabrik von innen aussieht. Aber dieser DDR-Betrieb war ziemlich
anders. Es hatte nicht den Anschein, als würde dort etwas produziert.
Halbfertige Teile standen herum und hatten schon Rost gefangen. Maria
führte mich in die "Entwicklungsabteilung" und zeigte mir
deren Computer. Im Westen war gerade der "Volkscomputer", der
Commodore VC 20, später der C64, in Mode gekommen. Was ich dort sah,
war groß und schwer und hatte nicht annähernd die Leistung.
Die Elektronenhirn mußte noch mit Hexcode gefüttert werden.
Man improvisierte viel. Neue Leiterplatten waren wohl nicht vorhanden,
aber man hatte noch eine Kiste mit Reststücken, damit werkelte man
herum. Die Arbeiter, die mangels Rohmaterialien wirklich nichts mehr zu
tun hatten, bastelten auf dem Werksgelände an ihren Trabis rum.
Während
des ganzen Besuchs war mir schon mulmig gewesen, doch dieses ungute Gefühl
steigerte sich zur blanken Angst, als Maria unerwarteterweise doch zu
irgendeinem Arbeitseinsatz gerufen wurde. Sie hatte mir vorher schon gesagt,
ich sollte so tun, als sei ich ein Lehrling aus einem Zweigbetrieb. Als
sie weg war, saß ich als Wessi also mit mir fremden Ossis im Forschungslabor
eines volkseigenen Betriebs und hatte nur ein einziges Ziel im Kopf: Möglichst
nicht aufzufallen, bis Maria wiederkäme. Es ging alles gut. Diese
Erfahrung zähle ich zu den größten Abenteuern in meinem
Leben.
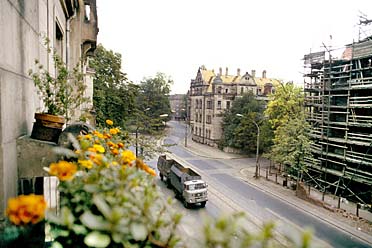
Dresden 1985:
Das hat mich damals total verblüfft:
Eine Hauptverkehrsstraße ohne ein einziges parkendes Auto!
Noch
'ne Erinnerung: U-Bahn-Fahren in Ost-Berlin.
Die Fahrt kostete 20 Pf. Sehr sozial[istisch]!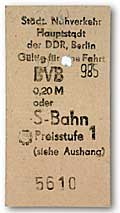 Besonders beeindruckend: Die Fahrscheine wurden aus Automaten gezogen,
in die man Geld einwerfen und aus denen man die Karten herauslassen konnte;
beide Möglichkeiten waren in dem Gerät jedoch technisch unabhängig
voneinander umgesetzt worden.
Besonders beeindruckend: Die Fahrscheine wurden aus Automaten gezogen,
in die man Geld einwerfen und aus denen man die Karten herauslassen konnte;
beide Möglichkeiten waren in dem Gerät jedoch technisch unabhängig
voneinander umgesetzt worden.
Das heißt: Fahrkarten bekam man soviele man wollte, unabhängig
davon, ob und wieviel Geld man eingeworfen hatte, und natürlich konnte
man auch Geld einwerfen, ohne eine Karte zu entnehmen. Es fanden aber
trotzdem stichprobenweise Fahrkartenkontrollen statt!
Kati
Lindemann, Frankfurt/Oder, Jahrgang 1978

"Wenn
es denn doch mal Negerküsse zu kaufen gab, was man entweder erfuhr,
wenn man zufällig in die Kaufhalle ging oder wenn man zielstrebig
ging, weil man gehört hatte, dass es mal wieder was besonderes gab,
dann musste man sich in jedem Fall beeilen. Die Negerküsse waren
rationiert, das hieß, dass man pro Käufer nur eine bestimmte
Anzahl kaufen durfte. Die gab es dann in braunen Papiertüten und
waren sehr lecker, aber auch viel kleiner, als die Dickmanns."
"Seit
meinem 5. Lebensjahr war ich beim Turnen. Die Sucher kamen schon in den
Kindergarten, um zierlich gebaute und sportliche Mädchen und Jungen
für den Leistungssport zu interessieren und langfristig auszubilden.
Ich kann mich noch erinnern, dass wir immer neidisch auf die Großen
waren, weil die "Brausepulver" bekamen und wir jüngeren
noch nicht. Außerdem durften die Älteren und Besseren eigene
Küren turnten, wir jedoch lange Zeit nur die "Einheitskür".
"Ich
kann mich noch erinnern, dass jemand aus meinem Ort uns für viel
Geld abfotografierte "BRAVO"-Bilder verkaufte. Das war für
viele die einzige Möglichkeit an Bildchen von ihren Stars zu gelangen."

"Während
unserer Jungpionierzeit wurden wir angehalten, Altstoffe zu sammeln. Wir
sind dazu immer mit Beuteln, die ganz Kleveren sogar mit Bollerwagen,
von Haus zu Haus gezogen, um nach alten Flaschen oder Zeitungen zu fragen.
Die haben wir dann entweder in der SERO-Annahmestelle abgegeben oder direkt,
im Wettkampf mit anderen Klassen, in der Schule gesammelt und dort dafür
Punkte bekommen. Am Ende eines Schuljahres war die Gesamtauswertung und
Klassenpreise für die besten Sammler."
(Geärgert hat uns immer, wenn Schüler aus Großfamilien
oder mit vieltrinkenden Eltern in diesem Wettstreit weit vorne lagen.)
"Jedes
Jahr zu Weihnachten und zum Geburtstag haben wir Westpakete von unseren
Verwandten geschickt bekommen. Deren Inhalt: Kaffee, Schokolade, Seidenstrumpfhosen,
Lux-Seife, abgetragene Sachen wie Samtpullover oder Jeans, Turnschuhe
mit Klettverschluss, Lebkuchen mit Füllung, Federhalter, Kakao, Barbies,
Mamba, Shampoo, Kaugummis und natürlich nicht zu vergessen: die Inhaltsliste."
"Eine
große Angst von vielen während der ersten Tage nach der Maueröffnung
war, dass es sehr wohl sein könnte, dass sie bald schon wieder geschlossen
wird. Das ist unter anderem auch eine Erklärung dafür, dass
so viele Menschen sehr schnell in den Westen sind, um mal zu gucken, wie
das da so ist."
"Plastiktüten,
wenn wir denn mal welche aus dem Westen bekamen, mussten oft umgedreht
getragen werden."
"Wenn
wir denn mal an Westgeld kamen, konnte es in 'Forumschecks' umgetauscht
werden. Mit diesen waren wir im Intershop und haben uns Matchbox, Tintenkiller,
Filzies, Ratzefummel und Schokolade gekauft."
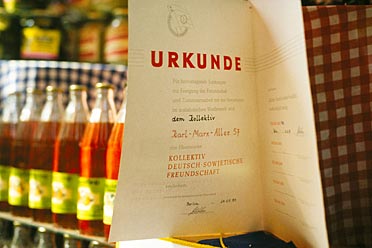
Auslage eines HO-Lebensmittelladens 1984.
Urkunde mit folgendem Text:
Für
hervorragende Leistungen
zur Festigung der Freundschaft
und Zusammenarbeit mit der Sowjetunion
im sozialistischen Wettbewerb wird
dem Kollektiv
Karl-Marx-Allee 57
der Ehrenname
KOLLEKTIV
DEUTSCH-SOWJETISCHE
FREUNDSCHAFT
verliehen.

Ost-Berlin 1984: Wahlaufruf auf Litfaßsäule:
"Wählt die Kandidaten der Nationalen Front"

Ost-Berlin, Hackesches Viertel 1984
heute von Touristen überschwemmtes Szeneviertel
C.
Franziska Richter, Dresden, Jahrgang 1978
Anmerkung
der Autorin: Der folgende Text beruht nur auf meinen Erinnerungen, ich
erhebe keinen Anspruch darauf, ein perfektes Gedächtnis zu haben
und bitte, falsche Bezeichnungen oder Ähnliches zu entschuldigen.
Auch sind meine Erinnerungen nicht vollständig wiedergegeben –
es gibt noch vieles mehr, was sich aber in persönlichen Gesprächen
besser erzählen läßt.
Diesseits
der Mauer – mein Leben in der DDR
Ich wurde 1978 in Dresden geboren. Dresden, das in der DDR als „Tal
der Ahnungslosen“ bekannt war, weil wir durch die geographische Lage
– im Elbtal – kein „Westfernsehen“ empfangen konnten.
Dresden, das als „Elbflorenz“ bekannt ist, weil architektonische
Bauten es zu einer der schönsten Städte macht, die ich kenne.
Das war auch früher schon so. Dresden, das nach der Wende –
wenn auch langsam, so doch stetig – einen wirtschaftlichen, städtebaulichen
Aufschwung erfuhr.
Und vor 1990?
Mein Leben bestand aus Kinderkrippenbesuchen, dann ein paar Jahre Kindergarten
– wo nicht etwa Beschäftigungstherapie stattfand, sondern wir
unsere Kindheit genießen durften – mit jeder Menge Spielzeug,
einem eigenen Swimmingpool [der damals allerdings einfach „Schwimmbecken“
hieß] und wo wir nebenbei schon erste Lesekenntnisse auf spielerische
Art und Weise vermittelt bekamen. Dann, im Herbst 1985, wurde ich in die
36. POS [Polytechnische Oberschule] eingeschult, wo man normalerweise
blieb, bis man seinen 10-Klassen-Abschluß gemacht hatte. Danach
stand dann die EOS an [Erweiterte Oberschule], die Entsprechung des Abiturs
als Voraussetzung für ein Studium. Aber zuerst wurden wir „Jungpioniere“
- eine Organisation für Kinder von der ersten bis zur fünften
Klasse. Für uns Kinder weniger politisch – bei uns ging es darum,
sich am Nachmittag zu treffen, miteinander zu sprechen, zu spielen und
Kontakte zu anderen Pioniergruppen zu halten. Später schlossen wir
auch Kontakt zu einer sogenannten „Patenbrigade“ – eine
Gruppe von Menschen, die in einem Betrieb tätig waren und uns von
ihrem Arbeitsleben erzählten – ob dies nun Produktion oder Büroarbeit
war. Außerdem schloß ich mich dem sogenannten „Timurtrupp“
an – auch der Titel eines meiner liebsten Kinderbücher lautete
so: „Timur und sein Trupp“ Aufgabe in diesem Verein war es meist,
älteren Menschen zu helfen. Ich ging für eine alte Dame einkaufen
und wurde von ihr mit Zuckereiern belohnt, die ich zwar nicht mochte,
aber ihr zuliebe aß. Das ist für mich eine der stärksten
Erinnerungen: wir taten solche Dinge freiwillig, ohne zu murren. Und es
war schön, dass man das Gefühl bekam, wirklich helfen zu können.
In der fünften Klasse dann wurde ich zum „Thälmannpionier“
– nach der Wende erstaunte es mich, zu hören, dass Thälmann
– obwohl in Hamburg geboren – in den alten Bundesländern
recht unbekannt war.
Ein Jahr später kam schon die Wende und mit ihr das Ende der DDR.
Überwiegend habe ich wohl positive Erinnerungen, was zum einen natürlich
der Tatsache geschuldet ist, dass ich noch sehr jung war und Dinge wie
Parteipolitik, Meinungsfreiheit etc. für mich noch nicht wirklich
eine Rolle spielten. Zum anderen wuchs ich in einem eher linksorientierten,
intellektuellen Haus auf und die Freunde meiner Eltern waren genauso liberal
wie meine Eltern selbst. Es gab politische Diskussionen, wie es sie auch
heute noch gibt, nur dass früher sicher vorsichtiger argumentiert
wurde.
Ich erinnere mich allerdings, einmal eine Klassenleitertadel bekommen
zu haben, weil ich angeblich das Staatsoberhaupt der DDR Erich Honecker
beleidigte – ich sagte, als ich ein Foto mit ihm und einer violett
und weiß gepunkteten Krawatte sah: „Boah, der Schlips, ey,
aus’m Ex, ey!“ ('Exquisit' – ein exklusives Bekleidungsgeschäft
in der DDR). Ob dieser Tadel nun gerechtfertigt war...? Allen Vorurteilen
zum Trotz gab es jedoch in der DDR Restaurants, genügend Lebensmittel
für alle und auch „E.T.“ lief im Kino (wenn auch mit Verspätung).
Thema
Lebensmittel:
Der Joghurt bestand aus Wasser und Milchpulver, sowie Geschmacksstoffen.
Als ich das erste Mal „Danone“-Joghurt aß (Pfirsich mit
Fruchtstücken!), dachte ich, ich esse Früchtequark. Milch gab
es in Glasflaschen oder Plastiktüten, die in den Geschäften
in Kisten lagen und von denen ein paar immer undicht waren. Pfirsiche,
Orangen, Bananen gab es nur zu bestimmten Jahreszeiten und die Menge wurde
pro Familie limitiert, so dass sich die Familienmitglieder einzeln anstellten,
um Obst zu kaufen. An diesen Tagen gab es immer Riesenschlangen vor den
Obstgeschäften. Die Brötchen waren (Entschuldigung an alle Bäcker)
viiieel besser – sie bestanden nicht hauptsächlich aus Luft,
wie heutzutage, sondern aus (Überraschung!) Teig. Es gab nicht 180
verschiedene Sorten von jedem Lebensmittel, sondern nur zwei. Aber man
musste wenigstens nicht stundenlang Preise vergleichen. Es gab Cornflakes!
Die Tüte kostete 1 Mark – und ähnelte den heutigen Kellogg's-Flakes
– auf die mit dem Hammer geschlagen wurde ;).
Thema
Medien:
Es gab verschiedene Tageszeitungen, die unterschiedlich politisch gefärbt
waren. Es gab „Das Magazin“, eine Unterhaltungszeitschrift,
die sich mit gesellschaftspolitischen Themen, Literatur und erotischer
Fotografie beschäftigte (gibt es auch heute noch), den „Eulenspiegel“
– ein politisches Satiremagazin (Ah! Sieh’ einer an!), die Frösi
(„Fröhlich sein und Singen“) – eine Zeitung für
Kinder. Die „Bummi“ – eine Zeitung für kleine Kinder,
die sich mit einem gelben Teddybär beschäftigte, der „Bummi“
hieß. Es gab auch ein Comic, das „Die Abrafaxe“ hieß.
Und weitere Zeitschriften, die der Unterhaltung dienten, u. a. für
Mode. Es gab zwei Fernsehsender, die nur durch die Zahlen 1 und 2 auseinander
gehalten wurden. Mein Lieblingsradiosender war DT 64. Es gab jede Menge
Bücher, wenn auch nicht alle. Aber „1984“ von George Orwell
wurde auch in der DDR verkauft, wenn auch „unter der Ladentheke“.
Thema
Politik:
Entgegen der landläufigen Meinung gab es fünf Parteien: CDU,
DBD, LDPD, NDPD, SED. Am ersten Mai gab es Maidemonstrationen, der Tag
des Arbeiters wurde gefeiert. Symbol war eine
rote Nelke am Knopfloch. Es gab jede Menge Kombinate, Vereinigungen und
politische bzw. nichtpolitische Feiertage, z. B.:
| 1.
März |
Tag
der Nationalen Volksarmee (NVA) |
| 24.
April |
Internationaler
Tag der Jugend und Studenten gegen Kolonialisierung und für friedliche
Koexistenz |
| 10.
Mai |
Tag
des freien Buches |
| 12.
Juni |
Tag
des Lehrers |
Ansonsten:
Im täglichen Leben wurde viel improvisiert und getauscht oder selber
hergestellt. Das MfS (Ministerium für Staatssicherheit) wußte
Dinge über uns, die mich erschreckten, als ich einen Blick in die
Akte meines Vaters warf, der mehrmals erfolglos angeworben wurde, um als
IM [Informeller Mitarbeiter] zu arbeiten und dem entgehen konnte, indem
er sagte, er könne „seinen Mund nicht halten“. Wir machten
Urlaub an der Ostsee, in Polen oder der (damaligen) CSFR. Den Taumel,
den ich in der Nacht vom 11. November 1989 empfand, werde ich nie vergessen,
auch wenn ich damals nicht alles verstanden habe, was um mich herum passierte.
Nun ist alles
anders. Manchmal frage ich mich, wie mein Leben verlaufen wäre, wenn
es die Wende nicht gegeben hätte. Und bin dankbar dafür, dass
es Gorbatschow gab. Und bin froh, dass alles so kam, wie es passiert ist
und das ich zwei politische Systeme erleben konnte. Und wenn ich eines
gelernt habe, dann ist es, dass es ideale Staatsformen nur auf dem Papier
gibt.
C. Franziska
Richter, Juli 2002
[cfr@happyplastic.de, www.happyplastic.de]
|
|